Der Luxemburger Schriftsteller Jean Sorrente (geb. 1954) wird u.a. im zeitgenössischen Belgien rege rezipiert: Zum Beispiel wurden seine Romane, Essays, lyrischen und prosaischen Texte mit wesentlichen Auszeichnungen bedacht, darunter dem Prix de la Libre Académie de Belgique.[1] Damit einhergehend bestreitet er in einem Interview eine Klassifizierung als Luxemburger Autor mit dem Hinweis, dass viele in seiner Familie Belgier*innen seien.[2]
Diese Auffassung steht nicht automatisch mit einer Rolle als ,Luxemburger’ Autor in Kontradiktion: Gemäß einer Erhebung von Honnef-Becker stellt das Thema der kulturellen Hybridität in der dortigen Literatur vielmehr einen signifikanten Fluchtpunkt dar.[3] Die Relevanz der Interkulturalität in Sorrentes Werk reflektiert exemplarisch sein Pseudonym „Sorrente“, das eine Anspielung auf eine antike Reise darstellt: Vergil soll nach Sorrente gereist sein, um der Venus ein Opfer darzubringen und die Erlaubnis zu erhalten, die „Aeneis“ fortzuschreiben.[4]

Diesbezüglich erscheint lohnenswert, der Bedeutung der kulturellen Offenheit in Sorrentes Texten einen Beitrag zu widmen. Inwiefern findet die Grunderfahrung des Reisens und Wanderns in seinen Texten einen Widerschein? Diesem Thema wird nachfolgend anhand von sowohl textimmanenten als auch textexternen Fakten nachgegangen.
Schreiben als Bewegung
Am 27.11.1954 in Belgien geboren, siedelte Jean Sorrente zum Studium nach Luxemburg über und entschied sich für ein Studium der französischen Literatur und Sprache[5] an den Cours Supérieurs. Anschließend promovierte er 1985 an der Universität Straßburg zu dem Humanisten und Essayisten Michel de Montaigne.[6] Montaigne selbst soll das Reisen zu Pferde zur einer Inspirationsquelle erhoben haben, wie es z.B. der Titel der Publikation „Montaigne en mouvement“ (Starobinski, Jean, Paris: Gallimard 1982) nahelegt.
In einem wahrscheinlich vergleichbaren Maße konstituiert sich gemäß dem Luxemburger Autorenlexikon Sorrentes Schreibweise durch Bewegung[7]. Laut dem vorliegenden Artikel schildern seine Prosatexte eine „[…] sowohl physische als auch mentale Bewegung, die Motive des Umherirrens sowie der Auflösung zum Vorschein bringen […].“[8] Dadurch ersetzen Zitate, Allusionen und Fremdheitserfahrungen als ästhetisches Ereignis festgezurrte narratologische Schemata wie z.B. lineare Erzählfäden, Kontinuität von Zeit und Raum.[9] Herumirren und Auflösung steht damit traditionellen Auffassungen konzeptionell gedachter Handlungsformen gegenüber. Dies bringt Autor wie Leser*innen in einen Fluss, welcher keine hermetisch abgedichteten Identitätsentwürfe mehr vermittelt.[10] Die Konzeption einer in sich geschlossenen Poetik wird demgemäß ersetzt durch eine von Offenheit geprägte Bewegung beim Schreiben und Lesen, welche Wanderungserfahrungen, sei es in real-physischer, sei es in übertragener, sprachlicher Art, ästhetisch erlebbar gestaltet.[11] In diesem Sinne versteht sich sein Werk als Zeichen interkultureller Fluidität und Öffnung.[12]
Wanderungsbewegungen durch Europa
Wie der Französische Schriftsteller Michel de Montaigne (…) schöpft Sorrente aus einem großen Fundus an literarisch-kulturellen Zitaten und Anspielungen, die aus verschiedenen Ländern eingewandert sind: Sie reichen von „[…] Autoren der Antike, Dante, Rilke, Mallarmé, Claude Simon, Pierre Michon, Bernard Noël oder, unter den Luxemburger Autoren, Edmond Dune“[13] bis hin zu dem Komponisten J.S. Bach und dem Künstler Picasso. Auf diese Weise übersetzt Sorrente fortwährend Fragmente aus Ton, Film und Text in sein eigenes Werk.[14] Traditionelle Elemente Homers, Dantes oder Mallarmés ,wandern’ durch dieses literarische Verfahren des Zitats in die Luxemburger Literaturlandschaft ein. Es handelt sich demnach um ein Schreibverfahren, das immer wieder Teile dessen einspielt, was seit Jahrhunderten (nicht nur) durch die europäische Literaturgeschichte reist.
Obendrein unternimmt Sorrente eine historische Wanderung durch die Kernereignisse europäischer Geschichte: In „La Guerre de temps“ (2020) stellt er die belgische Kooperation mit dem nationalsozialistischen Deutschland in den Mittelpunkt.[15] Dieses ausgreifende historisch fundierte Werk unternimmt eine Zeitreise von den 1930er- bis in die 1990er-Jahre und wurde deshalb als „Gedächtnisarbeit“[16] perspektiviert: Beschrieben wird zunächst die Kollaboration der Bruder Maintes mit den Besatzern, dann die sich hieraus ergebenden problematischen Lebensläufe nachfolgender Generationen: Fragen nach Schuld und Sühne, nach dem Umgang mit den eigenen Vorfahren, nach der Verführungsmacht von Ideologien schieben sich immer wieder in die Gegenwart hinein und beeinflussen den Alltag der Nachfahren.[17] Diese historischen Prozesse hallen in Sorrentes Roman durch die Zeiten und die Generationen, destabilisieren spätere Identitäten und lösen Selbstfindungs- und Reflexionsprozesse aus, die eine Auseinandersetzung mit den großen Themen des 20. Jahrhunderts als nicht abgeschlossen betrachten.[18] Die sich so ergebenden, mitunter schmerzhaften Denkprozesse stellt Sorrentes Roman in all ihrer emotionalen Abgründigkeit dar und sie zeigen, wie scheinbar Vergangenes die Gegenwart bewegt.
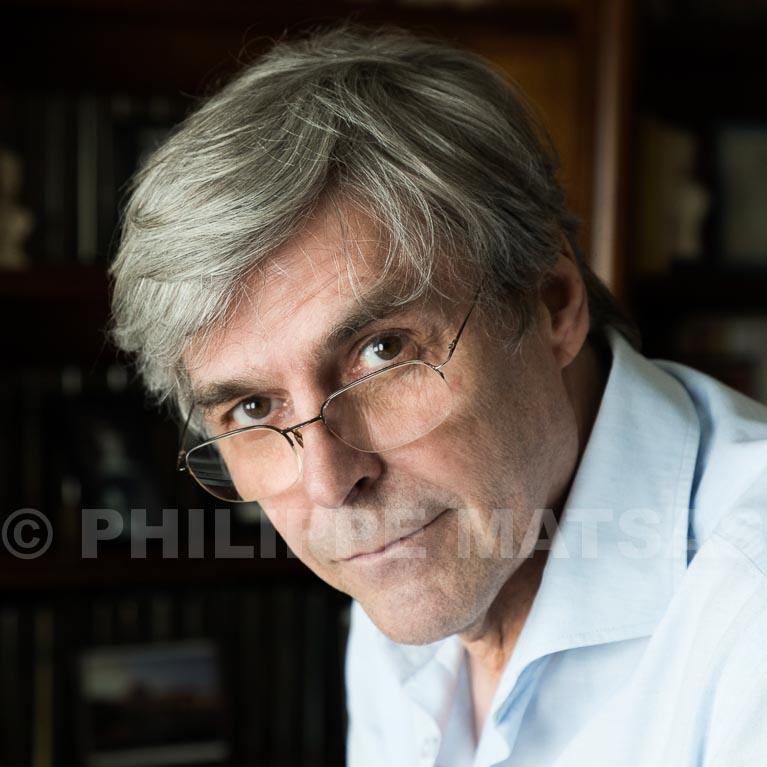
Öffnung als literarisches Paradigma
Des Weiteren werden nicht nur Ländergrenzen überschritten, sondern auch die Trennlinie zwischen Realität und Fiktion.[19] Zwischen Dokumentationen und historischen Zeugnissen finden sich stets fiktive Geschichten um Liebesbeziehungen, Affären, Freundschaften und persönliche Schuldverstrickungen eingewoben, die den Text zwischen Fakt und Erfindung oszillieren lassen.[20] Die Grenzen werden damit auch in dieser Hinsicht fluide. In Korrespondenz mit einer kulturellen Grenzöffnung weicht Sorrentes Geschichte die Abgrenzungen zwischen einem Bericht und dem Fiktiven auf und anstelle dessen finden sich eine Öffnung von Raum und Zeit, Irrwege, Diskontinuitäten und Handlungsfragmente.[21]
Insgesamt machen Sorrentes Texte daher den interkulturellen Austausch von Literatur produktiv: von der Odyssee[22] und dem Ort Sorrente, wo Vergil hinreiste[23], bis hin zu zeitgenössischer Autorinnen und Autoren durchwandert Sorrentes Art zu schreiben Zeiten, Kunstwerke und Kulturen. Statt einem klar präfigurierten Pfad zu folgen, bevorzugt er dabei einen reisenden ,Irrweg’, der keiner ist: So gestalten sich seine Texte in immer wieder anderer Form als Such- und Entdeckungsbild, die aufgrund zahlreicher Interferenzen zum Weiterlesen einlädt. Das Wandern und Reisen figuriert letztlich in seiner Poetik daher das Schreiben und Sein in einem abstrakten Sinne: sei es die Wanderung von Textfragmenten von einem Werk in ein anderes, sei es das Wandern zwischen den Sprachen, das in einem Verfahren des Zitierens und Querverweisens stets mitschwingt und die Texte lebendig vibrieren lässt.
Quellen
Irmgard Honnef-Becker: „Schreiben in mehr als einer Sprache. Mehrsprachigkeit in der Luxemburger Literatur.“ In: Heinz Sieburg (Hrsg.): Vielfalt der Sprachen – Varianz der Perspektiven. Zur Geschichte und Gegenwart der Luxemburger Mehrsprachigkeit. Bielefeld: transcript Verlag 2013.
Gast Mannes und Ludivine Jehin: „Jean Sorrente“. In: Luxemburger Autorenlexikon, Auf: autorenlexikon.lu, URL: https://www.autorenlexikon.lu/page/author/263/263/DEU/index.html. [zuletzt am: 10.10.2024].
Paca Rimbau Hernández: „JEAN SORRENTE: Ecriture faite à la main“ (Interview am 25.07.2003), auf: woxx.lu, URL: https://www.woxx.lu/739/ [zuletzt am: 10.10.2024].
[1] Vgl. Gast Mannes und Ludivine Jehin: „Jean Sorrente“. In: Luxemburger Autorenlexikon, Auf: autorenlexikon.lu, URL: https://www.autorenlexikon.lu/page/author/263/263/DEU/index.html. [zuletzt am: 10.10.2024].
[2] Vgl. Paca Rimbau Hernández: „JEAN SORRENTE: Ecriture faite à la main“ (Interview am 25.07.2003), auf: woxx.lu, URL: https://www.woxx.lu/739/ [zuletzt am: 10.10.2024].
[3] Vgl. Irmgard Honnef-Becker: „Schreiben in mehr als einer Sprache. Mehrsprachigkeit in der Luxemburger Literatur.“ In: Heinz Sieburg (Hrsg.): Vielfalt der Sprachen – Varianz der Perspektiven. Zur Geschichte und Gegenwart der Luxemburger Mehrsprachigkeit. Bielefeld: transcript Verlag 2013. S. 147ff.
[4] Vgl. Paca Rimbau Hernández: „JEAN SORRENTE: Ecriture faite à la main“ (Interview am 25.07.2003), auf: woxx.lu, URL: https://www.woxx.lu/739/ [zuletzt am: 10.10.2024].
[5] Vgl. Gast Mannes und Ludivine Jehin: „Jean Sorrente“. In: Luxemburger Autorenlexikon, Auf: autorenlexikon.lu, URL: https://www.autorenlexikon.lu/page/author/263/263/DEU/index.html. [zuletzt am: 10.10.2024].
[6] Vgl. ebd.
[7] Vgl. Ebd.
[8] Ebd.
[9] Vgl. ebd.
[10] Vgl. ebd.
[11] Vgl. Irmgard Honnef-Becker: „Schreiben in mehr als einer Sprache Mehrsprachigkeit in der Luxemburger Literatur.“ In: Heinz Sieburg (Hrsg.): Vielfalt der Sprachen – Varianz der Perspektiven. Zur Geschichte und Gegenwart der Luxemburger Mehrsprachigkeit. Bielefeld: transcript Verlag 2013. S. 147.
[12] Vgl. Irmgard Honnef-Becker: „Schreiben in mehr als einer Sprache Mehrsprachigkeit in der Luxemburger Literatur.“ In: Heinz Sieburg (Hrsg.): Vielfalt der Sprachen – Varianz der Perspektiven. Zur Geschichte und Gegenwart der Luxemburger Mehrsprachigkeit. Bielefeld: transcript Verlag 2013. S. 143.
[13] Gast Mannes und Ludivine Jehin: „Jean Sorrente“. In: Luxemburger Autorenlexikon, Auf: autorenlexikon.lu, URL: https://www.autorenlexikon.lu/page/author/263/263/DEU/index.html. [zuletzt am: 10.10.2024].
[14] Vgl. ebd.
[15] Vgl. Gast Mannes und Ludivine Jehin: „Jean Sorrente“. In: Luxemburger Autorenlexikon, Auf: autorenlexikon.lu, URL: https://www.autorenlexikon.lu/page/author/263/263/DEU/index.html. [zuletzt am: 10.10.2024].
[16] Ebd.
[17] Vgl. ebd.
[18] Vgl. ebd.
[19] Vgl. ebd.
[20] Vgl. ebd.
[21] Vgl. ebd.
[22] Vgl. ebd.
[23] Vgl. Paca Rimbau Hernández: „JEAN SORRENTE: Ecriture faite à la main“ (Interview am 25.07.2003), auf: woxx.lu, URL: https://www.woxx.lu/739/ [zuletzt am: 10.10.2024].